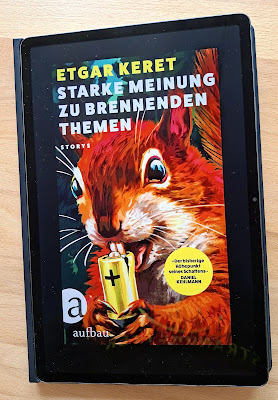Uketsu ist in Japan durch YouTube-Videos und Romane bekannt geworden und verschleiert die eigene Identität: Viele Medien schreiben und sprechen von Uketsu in der männlichen Form, doch das Tragen von Maske und schwarzem Ganzkörperanzug sowie das Verwenden eines Stimmverzerrers lassen keine wirklichen Rückschlüsse zu.
So mysteriös wie die Person ist auch Uketsus erster ins Deutsche übersetzte Roman Seltsame Bilder. Zwei Studenten, beide Mitglieder in einem Okkultismus-Club, tauschen sich über einen Blog aus, der schon eine ganze Weile nicht mehr aktiv ist. Der Blog gehört einem Mann, der zunächst von seiner Ehe, der Schwangerschaft seiner Frau und seinem Alltag erzählt. Doch es gibt offenbar Komplikationen. Der werdenden Mutter geht es mehrmals schlecht. In den besseren Phasen zeichnet sie Bilder, die ihr Mann als Ausdruck ihrer Freude über das bevorstehende Leben als kleine Familie deutet. Ein Irrtum, wie sich später herausstellen soll. Die Frau wird die Geburt ihres Kindes nicht überleben. Die Studenten lesen den letzten Eintrag des Bloggers, in dem dieser davon spricht, die Geheimnisse der Bilder entschlüsselt zu haben. Die Zeilen sind düster und geheimnisvoll.
Uketsu verzichtet auf eine chronologische Darstellung der Ereignisse, die sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten erstrecken und beginnen, als der unbekannte Blogger noch gar nicht geboren war. Damals erschlug ein Mädchen seine Mutter, als die seinen kleinen Vogel erdrosseln wollte. Aber dieser Mord wird nicht der einzige bleiben: Viele Jahre später wird ein Kunstlehrer auf einer Wanderung brutal ermordet. Man findet bei dem Toten eine ungelenke Zeichnung, die das Bergpanorama am Tatort zeigt. Die Polizei misst diesem Fund keine große Bedeutung bei. Nach einiger Zeit werden die Ermittlungen eingestellt.
Doch da ist der junge Mann, der in der Verwaltung einer Tageszeitung arbeitet. Er sieht sich als künftigen Investigativjournalisten und wird von einem früheren Reporter unterstützt. Doch ist das nicht völlig überflüssig, da ein Freund des Toten den Mord bereits gestanden hat? Die Schuld hat diesen Mann so sehr belastet, dass er anschließend Suizid begangen hat. Die Idee des jungen Zeitungsmitarbeiters, sich buchstäblich auf die Spuren des getöteten Kunstlehrers zu begeben, endet tödlich. Auch bei ihm wird eine dilettantisch gezeichnete Ansicht der Bergkette, die man vom Tatort aus sieht, gefunden. Es liegt nahe, dass es einen Zusammenhang zum früheren Mord geben muss.
Es treten nach und nach weitere Personen in die Handlung ein, die mit ihren Abgründen zunächst für sich zu stehen scheinen. Das, was lange zusammenhanglos erscheint, verdichtet sich später zu einem Netz von Menschen.
Lesen?
In Seltsame Bilder fügt Uketsu Text, Zeichnungen und Abbildungen mit japanischen Schriftzeichen zu einem Ganzen zusammen. Dabei werden viele Informationen über kulturelle Eigenheiten in Japan vermittelt. Ehre und Verantwortung spielen eine große Rolle und führen bis zur Verleugnung der eigenen Bedürfnisse. Kritische Bemerkungen werden nur vorsichtig formuliert; für Missverständnisse oder Fehler ist der Einzelne bereit, die Verantwortung zu übernehmen.
Über der Handlung liegt fast durchgehend ein atmosphärischer Grauschleier, das Unheil durchzieht das ganze Buch. Doch den Anspruch vieler Krimiautoren, die Leserinnen und Leser selbst kombinieren zu lassen, hat Uketsu offenbar nicht: Alles, was passiert, wird erklärt. Viele wichtige Details wirken allerdings unwahrscheinlich und konstruiert. Dazu gehören zum Beispiel auch die Bergzeichnungen der beiden ermordeten Männer. Logik ist an dieser Stelle nicht so wichtig.
Etwas redundant wird es, wenn bereits erläuterte Zusammenhänge noch einmal in Tabellen zusammengefasst werden. Dazu passt die einfache Sprache, die einerseits sehr schlicht ist, jedoch zur rätselhaften Atmosphäre beiträgt.
Für diejenigen, die nicht Japanisch schreiben können, erschließen sich leider die Abschnitte nicht, in denen es um sprachliche Auffälligkeiten geht. Hier wäre beispielsweise eine genauere Erläuterung im Anhang schön gewesen.
Alles in allem ist Seltsame Bilder mit Abstrichen ein empfehlenswertes Buch.
Seltsame Bilder erschien 2022 in der japanischen Originalausgabe und wurde 2025 in der deutschen Übersetzung vom Verlag Bastei Lübbe herausgebracht. Es kostet gebunden 24 Euro sowie als E-Book 6,99 Euro.